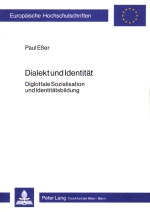Inhalt:
Es geht um die Frage, ob ein Kind, welches seine Sozialisation weitgehend durch ein sprachliches Medium leisten muss, das von wesentlichen Sektoren seiner gesellschaftlichen Umgebung diskriminiert wird, die für die Vertretung seiner Interessen nötige Ich-Stärke entwickeln kann. Kann es ein positives Selbst- und Weltbild entwickeln? Was widerfährt seinem Selbstverständnis bei einem forcierten Wechsel vom Dialekt zur Hochsprache, einem Wechsel von zwei Varietäten also, die beide als schichtspezifische Sozialsymbole fungieren und einen wichtigen Faktor der Identitätsbildung repräsentieren?
Aus dem Inhalt: U.a. Der Zusammenhang zwischen Sprachherkunft, sprachlichem Selbstverständnis und Persönlichkeitsentwicklung / Forderungen an einen dialektorientierten Sprachunterricht.
Inhaltsverzeichnis .pdf
Informationen:
Dialekt und Identität. Diglottale Sozialisation und Identitätsbildung
Europäische Hochschulschriften: Reihe 11, Pädagogik. Bd. 138
260 S. ISBN 978-3-8204-5832-9
Werbung: Peter Lang Verlag
Rezension:
Erstaunlich ist, dass dieses Werk über 40 Jahre und v.a. in neuerer Zeit immer noch (international) zitiert wird, u.a. in:
Raphaela Polk. Mehrsprachige Sprachbiografien und die Frage nach der Identität am Beispiel einer Minderheitensprache, Dresden 2022.
Eva-Elisabeth Kleinbrod. Dialekt als kulturelle Praxis der Bedeutungsproduktion. Eine interdisziplinäre Arbeit und qualitative Studie zur interpersonellen face-to-face Kommunikation im Dialekt am Beispiel des Vorarlberger Dialekts, Wien 2018.
Sandra Wondra. Sprachgebrauch im Internet aus Sicht der Silver Surfer, Wien 2018.
Anja Ballis/ Nazli Hodaie (Hg.). Perspektiven auf Mehrsprachigkeit, Berlin 2018.
Christian D. Sieber. Einfluss von scharfen und unscharfen Grenzen auf syntaktische Dialektunterschiede in der deutschen Schweiz, Zürich 2017.
Edyta Grotek/ Katarzyna Norkowska. „Sprache und Identität. Zur Einführung“, in: Edyta Grotek/ Katarzyna Norkowska (Hg.). Sprache und Identität – Philologische Einblicke, Berlin 2016, S. 9-18.
Lissi Bender. DEUTSCH IN SANTA CRUZ (DO SUL). Studium und Analyse der gegenwärtigen Situation der Sprache, Tübingen 2016.
Sonja Malić. Die Sicht auf Dialekte in Österreich – Eine Sprachwahrnehmungs- und Spracheinstellungsforschung von eingebürgerten MigrantInnen und Menschen mit Migrationshintergrund, Wien 2016.
Janette Baumann. Lokaljournalismus für nationale Minderheiten Reichweite, Funktionen und Bedeutung des Lokalen am Beispiel der Tageszeitungen Der Nordschleswiger und Flensborg Avis, Magdeburg 2015.
Boris Blahak. Franz Kafkas Literatursprache. Deutsch im Kontext des Prager Multilingualismus, Köln 2015.
Ulrike Thumberger. Regional and national identity in Austrian dialectal pop songs. A critical analysis of two Austropop songs, in: InterDisciplines 1 (2014), S. 1-35.
Sabrina Verena Kroisenbrunner. Dialekt in Salzburger Kindergärten. Eine Untersuchung zur Einstellung ausgewählter Salzburger KindergartenpädagogInnen, Wien 2014.
Stefan Röck. Kritische Würdigung geographischer Aspekte in der linguistischen Dialektforschung am Beispiel der deutschen Dialekte, Wien 2013.
Silvia Flögl. Strukturelle Entwicklungen im regionalen Varietätenspektrum – am Beispiel von Gernsheim und Gimbsheim. Eine empirische Studie zur modernen Sprachdynamikforschung des Deutschen, Pécs 2013.
Matthias Katerbow. Spracherwerb und Sprachvariation: eine phonetisch-phonologische Analyse zum regionalen Erstspracherwerb im Moselfränkischen, Berlin 2013.
Antonia Stabinger. Dialekt und Sympathie. Gegenseitige Wahrnehmung und subjektive Einschätzung sprachlicher Varietäten im deutschen Sprachraum, Wien 2012.
Réka Sánta-Jakabházi. Identität, Gattung und Form in Werk von Franz Hodjak, Budapest 2011.
Elvine Siemens Dück. Vitalidade linguística do Plautdietsch em contato com variedades standard faladas em comunidades menonitas no Brasil, Porto Alegre 2011.
Hans Dama. „Lexikale Einflüsse im Rumänischen aus dem österreichischen Deutsch“, in: Philologica Jassyensia, An II, Nr. 1, 2006, S. 105-110.
Esther Köber. I ben en türkischer Schwoab - Eine empirische Untersuchung zu den Bedeutungen und Funktionen des Schwäbischen im Integrationsprozess von MigrantInnen türkischer Herkunft, München 2006.
Jan Skrobanek/ Solvejg Jobst. „‘Begrenzung‘ durch kulturelles Kapital?“, in: Berliner Journal für Soziologie, 2006, № 2, S. 227-244.
Kurt Mühler/ Karl-Dieter Opp. Region und Nation. Zu den Wirkungen regionaler und überregionaler Identifikation, Wiebaden 2004.
Nina Janich/ Christiane Thim-Manbrey (Hg.). Sprachidentität - Identität durch Sprache, Tübingen 2003.
Karl-Heinz Bausch. Wandel im gesprochenen Deutsch. Zum diachronen Vergleich von Korpora gesprochener Sprache am Beispiel des Rhein-Neckar-Raums, Institut fur Deutsche Sprache, Mannheim, amades 3/2000.
Peter Schlobinski. Stadtsprache Berlin: Eine soziolinguistische Untersuchung, Berlin 1987.
Paul Eßer über seine Dissertation:
Es geht in dieser Untersuchung um eine Gruppe von Kindern, die aus verschiedenen Gründen benachteiligt sind. Meistens gehören sie der Unterschicht an und wohnen in den ärmeren Stadtvierteln oder in ländlichen Gebieten. Auf dem Gymnasium trifft man sie seltener als andere Kinder. Unter anderem erkennt man sie an ihrer Sprache: Sie sprechen Dialekt. Wenn sie nicht Dialekt sprechen, benutzen sie ein nicht sehr gepflegt klingendes Hochdeutsch.
Warum kommen diese Kinder nicht so recht voran in der Schule und im Leben? Weil sie Dialekt sprechen oder weil sie arm sind oder weil sie kein Selbstbewußtsein haben? Oder hängen diese Gegebenheiten vielleicht so eng zusammen, daß sie die Entwicklung der betroffenen Kinder gemeinsam und in gleicher Weise nachteilig beeinflussen?
Ich bin auch Dialektsprecher, aber meine Eltern haben mich auf ein Gymnasium geschickt. Ich bin nicht Bauarbeiter geworden, wie manche meiner Spielkameraden, sondern Lehrer. In meiner Jugend habe ich viele Jahre lang mit Dialektsprechern gelebt und gearbeitet: am Fließband, in der Landwirtschaft, im Straßenbau. Oft habe ich mit ihnen in unserer Sprache über unsere Sprache gesprochen. Vieles konnten wir nicht verstehen, vor allem nicht, daß die Leute, die Hochdeutsch sprachen, den Dialekt verachteten und ihn allenfalls benutzten, wenn sie Witze erzählten oder betrunken waren.
Jetzt habe ich die Dialektsprecher systematisch zu ihrer Sprache befragt und systematisch über ihre Probleme nachgedacht. Die Ergebnisse möchte ich in der folgenden Studie mitteilen.